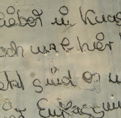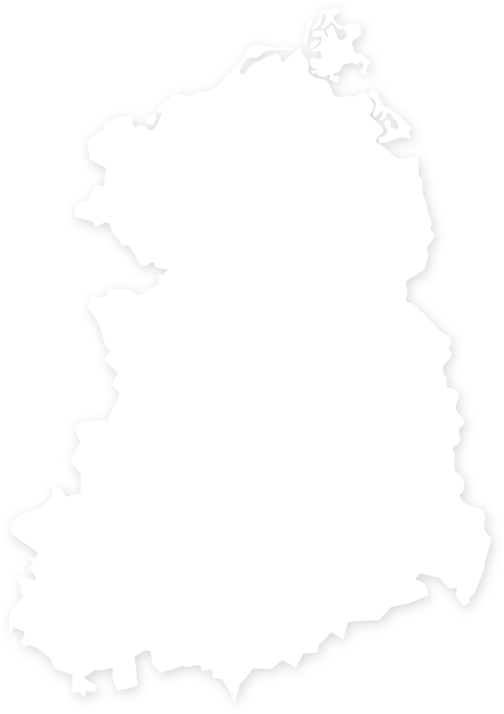Torgau, Jugendwerkhof



Der Jugendwerkhof wird im Mai 1964 im Gebäude eines ehemaligen Jugendgefängnisses eingerichtet. Hierher kommen Jugendliche aus anderen Spezialheimen, die dort durch Fehlverhalten auffallen. Der Alltag im Jugendwerkhof ist geprägt von strengen Regeln, scharfen Kontrollen und harten Strafen. Militärischer Drill beherrscht den Umgang der Erzieher mit den Jugendlichen: Sie müssen sich im Laufschritt fortbewegen, dürfen ohne Anordnung im Speisesaal nicht Platz nehmen oder aufstehen. Unterricht, Arbeit und Sport bestimmen den Tag, die Freizeit ist reglementiert. Ziel ist es, die Jugendlichen zwangsweise in die „sozialistische Gesellschaft" einzugliedern. Jede Aktivität findet immer in der Gruppe, im „Kollektiv", statt. Nicht Individualität, sondern allein die Leistung des Kollektivs zählt – auch Belobigungen und Bestrafungen gelten immer für alle. Sogar der Toilettengang erfolgt gemeinsam zu bestimmten Zeiten. Unter den Jugendlichen entstehen durch diesen ständigen Druck häufig „Hackordnungen": Die Stärksten setzen sich durch. 4.046 Jugendliche durchlaufen den Geschlossenen Jugendwerkhof bis zu seiner Schließung im November 1989.
Besucherinformation