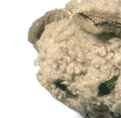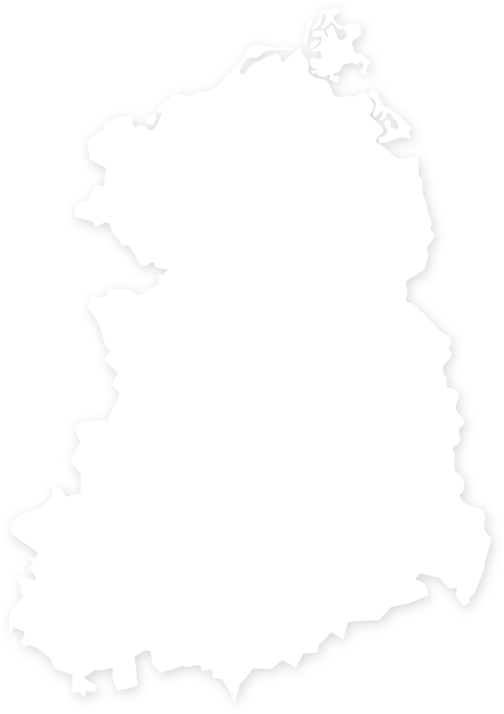Sachsenhausen
Nach Sachsenhausen werden die Häftlinge des Speziallagers Weesow nach dessen Auflösung verlegt. Die Versorgung im Lager ist katastrophal, Hunger und Krankheiten greifen um sich. Die Häftlinge schlafen in den Baracken auf rohen Holzgestellen. Erst zwei Jahre nach der Einrichtung des Lagers werden Strohsäcke verteilt. Arbeit gibt es wenig, die Häftlinge leiden unter der erzwungenen Untätigkeit. Das Speziallager ist von der Außenwelt fast vollständig abgeschnitten. Die Angehörigen der Häftlinge werden nicht über das Schicksal ihrer Verwandten informiert. Insgesamt werden mehr als 60.000 Personen in Sachsenhausen inhaftiert, 12.000 von ihnen sterben an den furchtbaren Haftbedingungen. Bei der Auflösung des Speziallagers im März 1950 wird die Mehrheit der SMT-Verurteilten in Haftanstalten der DDR überstellt. Ein Teil der Internierten wird in den „Waldheimer Prozessen" zu langjährigen Haftstrafen verurteilt.
Besucherinformation