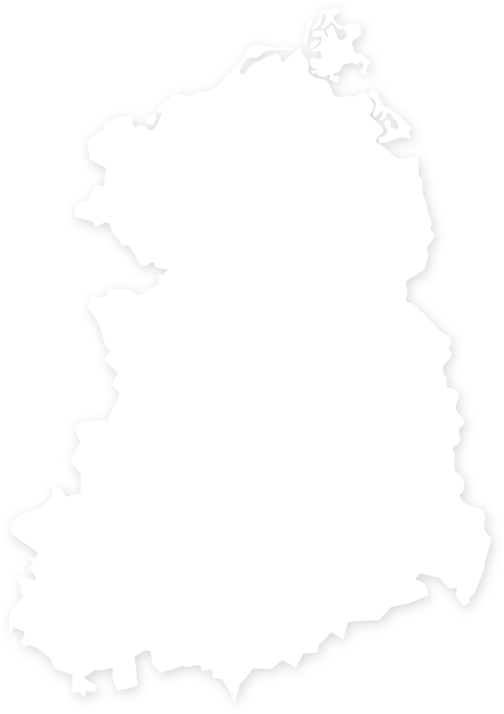Berlin-Hohenschönhausen


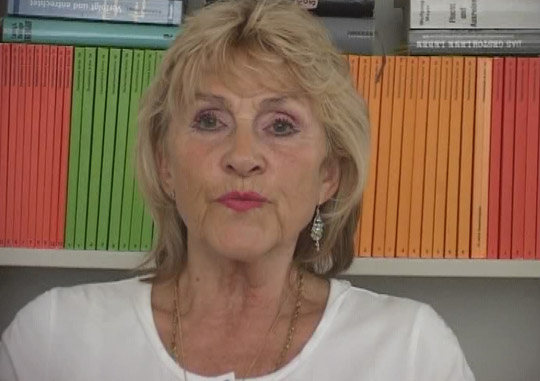

Der Name des Ost-Berliner Stadtteils, in dem das Gefängnis gelegen ist, wird neben Bautzen zum Inbegriff staatlicher Repression. Es befindet sich auf einem Gelände, das zuvor die nationalsozialistische Volkswohlfahrt nutzte. In der unmittelbaren Nachkriegszeit dient die Anlage dem sowjetischen Geheimdienst als Sammel- und Durchgangslager (Speziallager Nr. 3). Tausende werden hier festgehalten, mindestens 3.000 Häftlinge sterben in Folge katastrophaler hygienischer Verhältnisse und völlig unzureichender Ernährung. 1946/1947 wird das Gefängnis als zentrale Untersuchungshaftanstalt für die sowjetische Besatzungszone eingerichtet. Die Staatssicherheit übernimmt 1951 diese Einrichtung und baut Ende der 1950er Jahre einen neuen Gebäudetrakt mit über 200 Zellen und Vernehmerräumen. Der Komplex liegt in einem militärischen Sperrbezirk, der auf keiner Karte verzeichnet und hermetisch von der Außenwelt abgeriegelt ist.
Besucherinformation