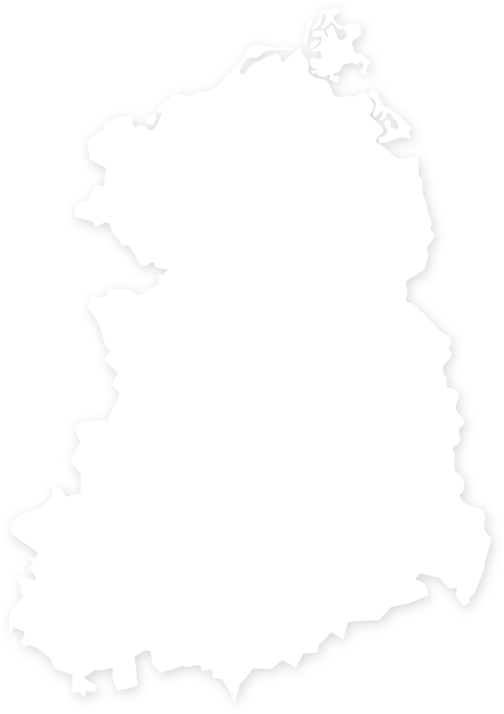Ketschendorf


Die Gefangenen leben dicht gedrängt. Ursprünglich für 500 Bewohner erbaut, hausen bis zu 10.400 Männer, Frauen und auch Kinder gleichzeitig in den leer geräumten ehemaligen Wohnhäusern. Durch die unerträgliche Enge, die völlig unzureichende Ernährung und die schlechten hygienischen Verhältnisse erkranken die Häftlinge extrem schnell, Tausende sterben. Die Überlebenden werden bis Mai 1947 in die Speziallager Sachsenhausen, Fünfeichen, Mühlberg, Jamlitz und Buchenwald verlegt, 315 noch Arbeitsfähige nach Sibirien deportiert. 1952/53 werden im Bereich der Massengräber neue Wohnhäuser errichtet. Jede Erinnerung an das Lager soll buchstäblich zugeschüttet werden. Unter Kontrolle der Staatssicherheit exhumiert eine Spezialfirma die Toten. Auf dem Waldfriedhof in Halbe ist bereits eine Grabstätte für die Toten eingerichtet, die im April 1945 bei der Schlacht um Halbe zwischen der Roten Armee und der Wehrmacht gestorben sind. Die Toten des Speziallagers werden hier beigesetzt, Tafeln weisen sie aus als „Unbekannt, verstorben im April 1945". Heute erinnern dort Steintafeln mit 4.621 Namen an ihr Schicksal. Auf dem Gelände des ehemaligen Lagers Ketschendorf (heute Fürstenwald-Süd) erinnert eine Gedenkstätte an das Lager und seine Opfer.
Besucherinformation