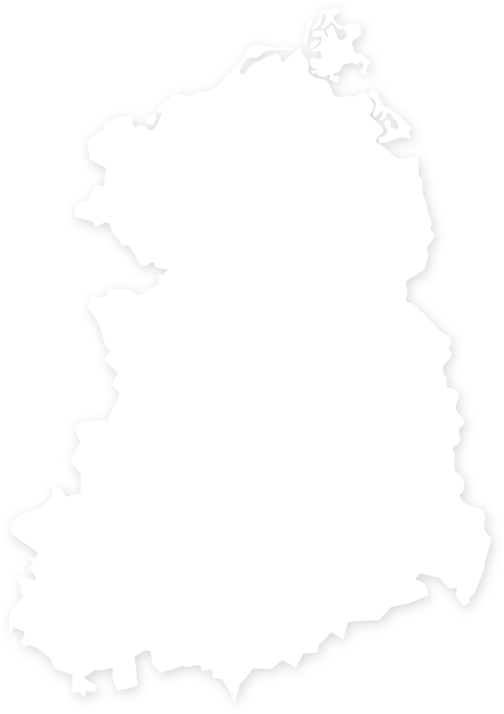Fünfeichen
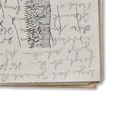

Die Nationalsozialisten errichten hier 1939 ein Kriegsgefangenenlager. Im Mai 1945 übernimmt der sowjetische Geheimdienst NKWD das Lager, etwa 15.400 Menschen werden inhaftiert. Durch Hunger und katastrophale hygienische Bedingungen sterben bis zur Auflösung der Einrichtung im Januar 1949 mehr als 4.900 Inhaftierte. Um Kontakte der Häftling untereinander zu unterbinden, ist das Lager in verschiedene Zonen eingeteilt. Das Nordlager ist mit einer Mauer und elektrisch geladenem Stacheldraht hermetisch abgetrennt. Wie in den anderen sowjetischen Speziallagern sind auch in Fünfeichen die Häftlinge bis auf wenige Ausnahmen nicht verurteilt, sondern werden willkürlich festgehalten. Etwa zwanzig Prozent der Inhaftierten sind Jugendliche. Anders als in anderen Speziallagern dürfen viele der Internierten arbeiten. Sie werden auch außerhalb des Lagers in der Landwirtschaft eingesetzt.
1959/60 wird in der DDR eine Erinnerungsstätte für die Opfer des Kriegsgefangenenlagers eingerichtet, jedoch nie eröffnet. Die Nationale Volksarmee (NVA) nutzt das Gelände bis 1989 als Übungsplatz. Im April 1993 wird die Mahn- und Gedenkstätte Fünfeichen eröffnet, wo auf 59 Bronzetafeln auch der Opfer des sowjetischen Speziallagers gedacht wird.
Besucherinformation